Liebeskummer. Aus Sicht der Trauma Philosophie. Die meist verharmloste traumatische Erfahrung
- 11. Jan. 2021
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 16. Nov. 2023
Jeder kennt es: die Schmerzen einer Trennung. In extremen Fällen sind diese Schmerzen so unerträglich, dass Menschen lieber sterben, als sie weiter ertragen zu müssen. Auch wenn in vielen Fällen Trennungen wesentlich unauffälliger verlaufen, sind sie deswegen nicht weniger schmerzhaft. Dennoch wird diese leidvolle Erfahrung immer noch als „Liebeskummer“ abgetan und verharmlost. Auch wenn es verständlich ist, dass wir für ein Geschehen, dass so häufig vorkommt, einen Namen finden, der die Dramatik herunterspielt, ist es gerade deswegen – vor allem für den Typ Mensch den ich „existenziell“ (oder in einem speziellen Sinn: traumatisiert) nenne – entscheidend zu wissen, dass es sich hier um keine Kleinigkeit handelt, sondern um eine Aufgabe die an den Kern der Existenz greift.
Zu einer angemessenen Auslegung der Trennung führt die Frage: Was ist die Ursache für den Schmerz und vor allem: wo spüren wir ihn? Es ist unbestreitbar, dass die Trennung von einem geliebten Menschen körperlich spürbare Schmerzen verursacht. Aber was genau, welcher Teil des Körpers schmerzt da eigentlich? Wie lässt sich dieser (Phantom-) Schmerz des abgetrennten Anderen denken und lokalisieren?
Im allgemeinen Verständnis übertragen wir das Bild der körperlichen Verletzung ins Seelische. Wir sind gewohnt die Schmerzen einer Trennung als eine Art „seelische Verwundung“ zu denken. Aber auch wenn Formulierungen wie: „meine Seele blutet“ poetisch und emotional stimmig sind: sie sind doch nur Metaphern für ein grundlegend missverstandenes Geschehen. Wir können die Seele nicht bluten sehen.
Oder doch? Neueste Diagnoseinstrumente, die ins Innerste des Leibes eindringen, zeigen nachweisbare physische Veränderungen in Trennungsprozessen, typische Stressreaktionen: Hormone und Botenstoffe im Blut verhalten sich anders, und im Gehirn leuchten Areale, die sonst unauffällig blieben. Der „seelische“ Vorgang findet also tatsächlich und nachweisbar seinen körperlichen Niederschlag. Aber diese sichtbaren körperlichen Veränderungen beantworten die Ausgangsfrage nicht, denn die Nachweise sind ja nicht Ursache, sondern Folge einer Trennung und des damit verbundenen Schmerzes. Hormonelle und neurologische Tatbestände erzeugen den Schmerz nicht, sie zeigen ihn nur an, so wie ein Symptom die Krankheit. Das pneumatische Geschehen kondensiert in den Zellen. Aber woher kommt der Schmerz, wo ist er tatsächlich lokalisiert?
Eine angemessene Antwort auf diese Frage muss im Dunkeln bleiben, solange wir uns den Menschen weiter als Individuum vorstellen, als individuelles „Selbst“. Wenn das „Ich“ bis in die letzte metaphysische Instanz als ein

radikal getrenntes „Ich“ gedacht wird, folgt daraus, dass „Egologie“ (Lévinas) die Regel und Beziehung die Ausnahme ist. Für ein autonomes Ich ist Beziehung etwas, das dieses Selbst aufnehmen und eben auch wieder lassen kann. Es gibt ein Davor und ein Danach und man könnte sagen, nur dann ist man auch wieder ganz „Selbst“. Ein Menschenbild, das eine lange philosophische Tradition hat und auch die umgangssprachliche Interpretation leitet („Ich bin eine Beziehung eingegangen“). Ein Bild, das aber auch den Grundstein legt für die Verharmlosungen und Missverständnisse in Verbindung mit Trennungsprozessen: Wenn wir von einem autonomen Selbst ausgehen, dann führt eine Trennung nur wieder dahin zurück. Selbst Sigmund Freud muss dieses Bild eines selbständigen „Seelenkörpers“ vor Augen gehabt haben, wenn er davon spricht, dass wir andere mit „Libido Energie“ besetzen und diese Libido am Ende einer Beziehung quasi wieder in uns selbst hineinsaugen:
Es hatte eine Objektwahl, eine Bindung der Libido an eine bestimmte Person bestanden; durch den Einfluss einer realen Kränkung oder Enttäuschungvon seiten der geliebten Person trat eine Erschütterung dieser Objektbeziehung ein. Der Erfolg war nicht der normale einer Abziehung der Libido von diesem Objekt und Verschiebung derselben auf ein neues ,... die freie Libido {wurde} nicht auf ein anderes Objekt verschoben, sondern ins Ich zurückgezogen.
S. Freud: Trauer und Melancholie.
Die Heftigkeit und Hoffnungslosigkeit, das Überwältigende und Lebensbedrohliche des Trennungsschmerzes wird in diesem Bild nicht sichtbar.
Um die ganze Dramatik des Geschehens angemessen sichtbar zu machen und zu verstehen, ist nichts weniger notwendig als ein Paradigmenwechsel. Der neue Denkansatz muss sich dann völlig von der Vorstellung eines autonomen, selbständigen „Ich“ lösen. Die phänomenologische Annäherung an die Schmerzen einer Trennung beginnt nicht mit Eins, sondern mit Zwei: Die kleinste vorstellbare Einheit ist kein wie auch immer gedachtes losgelöstes Individuum, kein völlig eigenständiges „Selbst“, kein transzendentales Ich. Die kleinste mögliche Einheit sind Ich und Du. Diese unhintergehbare ontologische Angewiesenheit auf einen „intimen Ergänzer“ (Sloterdijk), ist die Erklärung für die unerträglichen Schmerzen einer Trennung.
Den Beweis für diese These zu führen erfordert Seminare und sprengt bei weitem den Rahmen dieses Formats. Ich kann den philosophischen Gedankengang für Interessierte und Betroffene hier nur skizzieren und auf kommende Angebote verweisen: Es beginnt mit einer phänomenologischen Analyse des Menschseins. Der Weg führt über Ontologie und ein Verständnis von Dasein als Mitsein im Sinne Heideggers über die Dialogphilosophie und das „Grundwort Ich-Du“ im Sinne Bubers zur Beanspruchung des Selben durch den Anderen im Sinne Lévinas’ zur Leibphilosophie von Schmitz und schließlich zur zusammenfassenden Conclusio bei Sloterdijk: Der Anfang ist dyadisch.
Wir sind, was wir sind, ohne Trennung und Fuge: dieser Glücksraum, diese Vibration, diese beseelte Echokammer. Wir wohnen, als ineinander Verschränkte, im Lande Wir.
P. Sloterdijk: Sphären. Band 1.
Die Theorie ist abstrakt und bedarf der Einführung. Die Konsequenzen für die Praxis sind dafür umso deutlicher und dringender: wir sollten Liebeskummer als Trennungstrauma verstehen und die damit verbundenen Schmerzen sehr ernst nehmen. Das gilt für Betroffene, weil es bedeutet, dass wir milden Blicks und verzeihend auf unsere Schmerzen blicken dürfen, anstatt den Schmerz zu vertiefen indem wir uns „Ich-Schwäche“ vorwerfen; es gilt vor allem aber auch für Berater und Therapeuten, die die Dramatik des Geschehens verinnerlichen müssen, wenn sie authentisch unterstützen wollen.

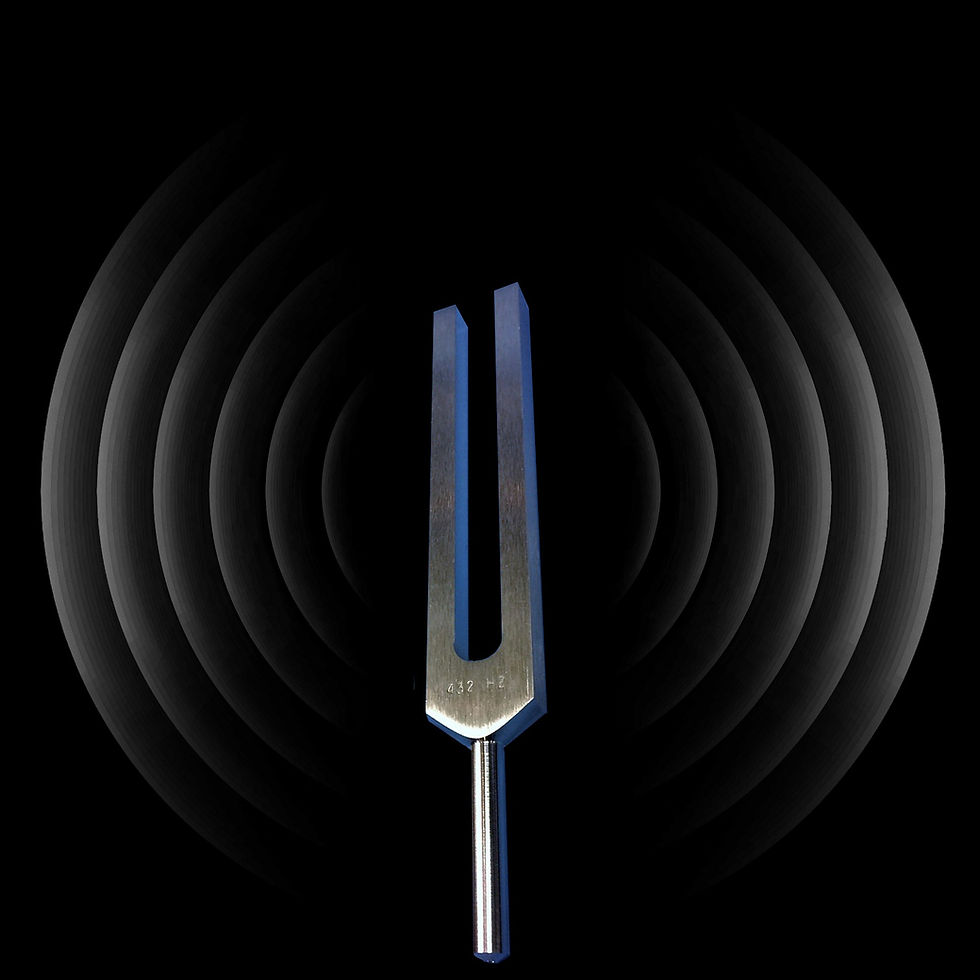

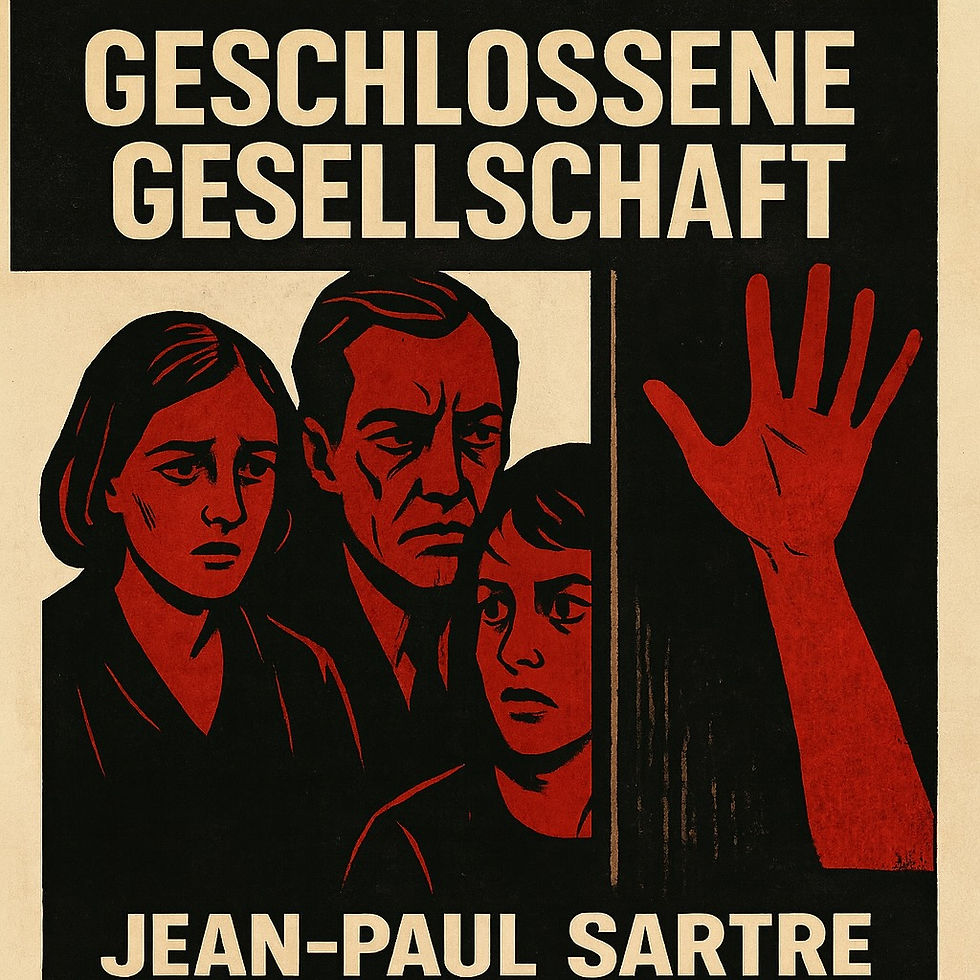
Kommentare