Die Liebe.
- Manfred Rühl

- 6. Apr.
- 13 Min. Lesezeit
Traumatisch. Pragmatisch. Existenziell.
Das Wesen der Liebe liegt darin, Antwort auf das Trauma der Existenz zu sein.
In vielen meiner philosophischen Gespräche seit Jenseits von Afrika werde ich auf den Unterschied zwischen Beziehungsliebe und Begegnungsliebe angesprochen. Das bringt mich dazu, das Phänomen der Liebe aus Sicht der Traumaphilosophie noch einmal genauer darzustellen. In diese Darstellung fließen meine persönlichen Erfahrungen ebenso ein wie eine Liebesphilosophie, die sich abgrenzt von biologischen Reduktionen, romantischen Überhöhungen und der herkömmlichen Teilung der Liebe in Eros, Philia und Agape. Was ich hier zur Sprache bringen möchte, ist die Liebe in ihrer traumatischen, pragmatischen und existenziellen Form. Wenn Menschsein bedeutet, mein Sterben bewusst übernehmen zu müssen, dann ist die Liebe Antwort auf diese Endlichkeit.
Ich betrachte das Phänomen der Liebe also existenziell, in bewusster Gegenposition zu den materiellen Erklärungen der (Neuro-) Biologie. Ich denke, wir verfehlen das Wesen der Liebe, wenn wir sie auf ihr physiologisches Substrat reduzieren. Als Vorläufer dieser reduktionistischen Sichtweise sehe ich Arthur Schopenhauer, der die Liebe auf ein Mittel zum Zweck eines transzendenten Willens zum Leben reduziert. Er stellt fest:
"Denn alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich auch gebärden mag, wurzelt allein im Geschlechtstrieb … Was im individuellen Bewusstsein sich kund gibt als Geschlechtstrieb …, das ist an sich selbst … der Wille zum Leben. Der Endzweck aller Liebeshändel, …, ist nichts Geringeres als die Zusammensetzung der nächsten Generation." (A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Metaphysik der Geschlechtsliebe.)
Ein transzendenter Wille macht die Liebe zwischen Mann und Frau (Homoerotik bleibt in diesem Bild ein Problem) zum Instrument einer Inkarnation, die sich selbst will. Das Leben will weiterleben und zwingt zwei Menschen dazu sich zu verlieben, damit optimaler Nachwuchs entsteht. Von dieser transzendent gedachten Nötigung ist es nur ein kleiner Schritt zur Theorie des Biologen Richard Dawkins:
"Irgendwann bildete sich zufällig ein besonders bemerkenswertes Molekül. Wir nennen es Replikator. ... es besaß die außergewöhnliche Eigenschaft, Kopien seiner selbst herstellen zu können.
Es überlebten diejenigen Replikatoren, die um sich herum Überlebensmaschinen bauten.
Sie haben einen weiten Weg hinter sich, diese Replikatoren. Heute tragen sie den Namen Gene, und wir sind ihre Überlebensmaschinen." (R. Dawkins. Das egoistische Gen. Springer 2007)
Dawkins eliminiert die Transzendenz aus der Gleichung und reduziert den Menschen auf eine Marionette einer egoistisch agierenden DNA. In diesem Bild ist der Mensch Sklave seines Genoms, die Liebe nur Mittel zum Zweck der Arterhaltung.
Diese Linie führt weiter zu den modernen neurowissenschaftlichen Theorien, die sich auf Spiegelneuronen berufen oder Botenstoffe. Liebe wird physiologisch nachweisbar, bleibt als Phänomen aber ein Rätsel. Fakt ist: Für mein wirkliches Leben, für meine Gefühle und meine Liebeserfahrungen sind diese Erklärungen vielleicht intellektuell interessant aber praktisch völlig bedeutungslos, da sie mir keinerlei Anweisung geben was zu tun wäre.
Anweisung wie zu lieben ist kommt dafür sehr vehement von soziologischer Seite: handlungsleitend ist unser gesellschaftliches Ideal der romantischen Liebe. Dieses Ideal ist so tief in unserer Kultur verankert, dass sich die Grenze zwischen meinen individuellen Liebesgefühlen und der gesellschaftlichen Liebesnorm kaum ziehen lässt. Die Soziologin Andrea Newerla erstellt diesen Befund in ihrem Buch über das Ende des Romantikdiktats. Sie spricht eine deutliche Sprache und schildert ihr eigenes Leben nicht nur unter dem Einfluss eines romantischen Ideals stehend, sondern als erzwungene Reaktion auf ein Diktat: das Romantik-Diktat. Die Freiheit zu lieben ist in diesem Bild ebenfalls einem Zwang unterworfen, diesmal soziologisch, nicht biologisch.
"Den Wenigsten von uns ist bewusst, dass das Skript, dem unsere Liebesgeschichten folgen, bereits feststeht und seit Jahrhunderten ungefähr gleich abläuft: Verliebt, verlobt, verheiratet – oder moderner: daten, crushen, verlieben, zusammenziehen, Kinder kriegen, Familie werden."
(A. Newerla: Das Ende des Romantikdiktats. Kösel 2023. S. 12f)
Newerla fordert uns auf, eine Geschichte ernsthaft zu überdenken, die wir alle kennen. Es ist die Geschichte, die wir immer und immer wieder gehört, gelesen und unzählige Male verfilmt gesehen haben. Es ist die sich ständig wiederholende Geschichte des platonischen Kugelmenschen. Diese Geschichte kreist um die Vorstellung, dass es einen Menschen gibt, der mich erfüllt. Das romantische Hollywood Genre hat dieses Ideal unzählige Male wiederholt und verkauft. „You complete me“, sagt Tom Cruise als Jerry Maguire in der berühmten: „You had me at Hello“ Szene. So soll es sein, so sollte es sein. Alles andere ist Zwischenspiel, Kompromiss, nicht das Wahre. Diese Vorstellung von Liebe steuert weitgehend unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Mit Newerla finde ich: es ist höchste Zeit, das Märchen vom Prinzen und seiner Prinzessin ernsthaft in Frage zu stellen.
Was uns zu der Frage führt, wodurch das romantische Liebesideal zu ersetzen wäre. Newerla bleibt hier eher vage, spricht von der „erweiterten Familie“ und vom „Kreis der Liebe“. Ich werde im Folgenden meinen eigenen Vorschlag machen und ich versuche so konkret wie möglich zu sein.
Für mich steht fest: Der Grund für den Siegeszug der romantischen Liebe liegt erst im zweiten Schritt im Außen, in gesellschaftlichen Erwartungen und Normen. Im ersten Schritt bedient diese Vorstellung eine Sehnsucht im persönlichsten Innen. Romantisch gefühlte Liebe speist sich direkt und unbewusst aus dem existenziellen Trauma, indem sie einen Ausweg aus der Tragik der einsamen Sterblichkeit verspricht. Aus diesem Grund ist romantische Liebe mit dem stärksten Liebesgefühl verbunden, das wir kennen: der Verliebtheit. Verliebtheit ist traumatischen Ursprungs und die erste Art zu lieben, über die ich hier sprechen will. Verliebtheit ist die Hoffnung auf Erlösung vom Trauma der Vereinzelung. Verliebtheit ist das Gefühl des „You complete me“. Wir fühlen einen Menschen, der uns vervollständigt.
Aber wie soll das möglich sein? Was genau wird hier vervollständigt? Was braucht „Er-Füllung“? Diese Frage sollten wir stellen, diese Frage will ich hier stellen. Mit Schopenhauer könnte ich sagen: Alle Verliebtheit, so ätherisch sie sich auch gebärden mag, wurzelt allein im Trauma.
Verliebtheit ist keine bewusste Entscheidung, sondern eine zufallende Befindlichkeit, in dem einem einsamen ICH ein verheißungsvolles DU gegenübertritt, das den Weg zu einem Trauma-lösenden WIR zu öffnen scheint. Verliebtheit ist als Emotion so stark, weil sie das positive Extrem zum negativen Extrem des Traumas ist. Der Mensch, auf den diese Emotion projiziert wird, soll das ursprünglich traumatisierende NEIN zu mir in ein heilendes JA zu mir verwandeln. Verliebtheit ist der Ausgangspunkt der romantischen Liebe, bei der es im Kern darum geht, ein NEIN in ein JA zu wandeln.
Das NEIN, verstanden als traumatisierende Vernichtung eines Teils meines Selbst, ist der Ursprung des Traumas und der Grund für die Leere, die in der Verliebtheit gefüllt werden soll. Dieses NEIN muss kein ausgesprochenes Nein sein - ist es sogar selten - häufiger ist es ein systemisches NEIN. Ein systemisches Nein bedeutet, dass mein Platz mit einer Verneinung belegt ist oder war. Diese Verneinung ist im schlimmsten Fall Gewalt: das NEIN zu meiner körperlichen Unversehrtheit. Zumeist ist es eine emotionale Verneinung: das NEIN zu meiner Freiheit, weil mein Platz an der Seite der depressiven Mutter sein musste. Das NEIN zu meinen Bedürfnissen, weil sie nicht so dringend waren wie die des bedürftigeren Geschwisters. Das NEIN zu meiner Suche nach Geborgenheit, weil der Vater nie da war, um sie mir zu geben. Das NEIN zu meinem Wunsch nach Sicherheit, der der Unberechenbarkeit meiner Eltern zum Opfer fiel. Die Liste der möglichen Verneinungen ist lang. Wo dieses NEIN traumatisierend wird, löst es im Hintergrund eine lebenslange Suche nach dem erlösenden, korrigierenden JA aus. Wenn wir endlich den Menschen gefunden haben, dem wir dieses JA zutrauen, dann… verlieben wir uns.
In der Verliebtheit liegt eine Chance und eine Gefahr. Wir können ein weiteres Mal das NEIN erfahren und das Trauma wird aktualisiert. Vielleicht ist es in Ausnahmefällen auch möglich, ein für alle Zeit erlösende JA zu erfahren, diese Hypothese bleibt, aber es bleibt eine Ausnahme.
In den weitaus meisten Fällen geht die Geschichte anders weiter. Eines wird im Verlauf der abnehmenden Verliebtheit nämlich immer deutlicher: Der andere ist ein ganz ANDERER. Er ist nicht reduzierbar auf das JA, das ich brauche. Mein Bedürfnis nach diesem erfüllenden JA ist eine Überforderung.
Wenn klar wird, dass die Sehnsucht nach Erlösung nicht erfüllt wird, wenn die Verliebtheit nachlässt, der andere als ANDERER erkannt wird, zerstört das die Illusion und macht Platz für die Möglichkeit des re-traumatisierende NEIN. Wo das JA der Liebe hätte sein sollen, kommt es nun zum NEIN des Traumas. Wenn das JA zum Ich ausbleibt, folgt nur allzu oft das NEIN zum Du. Das Trauma des NEIN wird aktualisiert und weitergegeben. Alles, was der/die Geliebte nicht sein konnte, wird nun zu dessen Schuld. Die Verliebtheit kühlt schlagartig aus oder erhitzt sich im eskalierenden Konflikt. Spätestens hier wird deutlich, dass es nie um echte Liebe zwischen einem einsamen Ich und einem einsamen Du ging, sondern um die Hoffnung auf Erlösung, wie sie unter Menschen nicht möglich ist. Der Anspruch der Verliebtheit orientiert sich an der grenzenlosen Liebe Gottes, die sie nicht sein kann. Jedes wahre DU, jeder echte Mensch ist begrenzt und begrenzend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir an diese Grenze stoßen. Dann zeigt sich das hässliche Gesicht des Romantikideals: Trauer, Wut, Vergeltung oder Depression sind Reaktionen auf das Ende der überfordernden Liebe. Die Tatsache, dass wir als Gesellschaft aggressive Reaktionen auf diesen Verlust positiv bewerten, d.h. dass es gerechtfertigt scheint, den ehemals Geliebten zum Betrüger und damit zum legitimen Ziel meiner Wut zu machen, treibt die Eskalation weiter an. Der traumatische Teufelskreis bestätigt sich selbst, umso dringlicher steht die Frage nach Alternativen im Raum.
Wer den Trauma-gesteuerten Romantikzirkel durchschaut hat und aufhört, die Erlösung beim anderen zu suchen, dem bietet sich eine – allerdings in dieser Gesellschaft wenig beliebte - Alternative: die pragmatische Liebe. Verliebtheit muss nicht zwangsläufig im Trauma enden. Sie kann in eine andere Form der Liebe gewandelt werden, die in unserer Kultur leider eher abschätzig behandelt wird, aber großen ethischen Wert besitzt. In der pragmatischen Liebe ist der andere als ANDERER akzeptiert. Die berühmte „rosarote Brille“ ist weg, die großen Gefühle ebenfalls. Was jetzt? Was tun mit diesem fehlerhaften, unvollständigen Menschenexemplar, das mir noch dazu ständig vor Augen führt, dass ich selbst auch nicht perfekt bin? Ich muss mich entscheiden. Laufe ich ein weiteres Mal dem Ideal der romantischen Liebe nach, das sich mit „gut genug“ nicht zufriedengibt (vgl.: Ted Lasso: „Don’t settle for fine. You deserve better.“)? Suche ich ein weiteres Mal nach der „großen Liebe“, oder akzeptiere ich die Fehlbarkeit und Unvollkommenheit in meiner Beziehung und gebe ihr gerade deswegen einen besonderen Wert?
Ich weiß, jeder kennt ein Paar, das – von außen gesehen – das romantische Ideal gelebt hat. 50 Jahre glücklich verheiratet. Diese scheinbaren Ausnahmen halten den Mythos am Leben. Dem entgegen behaupte ich, dass hinter dieser Treue nicht die romantische Liebe, sondern das Bekenntnis zur pragmatischen Liebe steht. Eine Liebe, die in ihrem Kern einen zentralen Wert lebt: Loyalität. Loyalität ist mehr als ein Gefühl. Es ist eine immer wieder zu treffende Entscheidung. Eine echte Wahl, in der ich den anderen als ANDEREN wähle. In der pragmatischen Liebe ist das eigene Trauma zumindest soweit durchsichtig, dass ich nicht mehr erwarte, vom Partner erlöst zu werden. Er ist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Wir sind auch kein zu einer Einheit verschmolzenes Wir. Wir leben vielmehr ein dankbares und respektvolles Ich und Du, bei dem beide Seiten wissen, was sie füreinander sind und einander auch sein lassen können. Gerade dieses Sein – lassen, im Sein belassen, ist der Schlüssel zu dieser Liebe. Sie vollzieht sich in der gemeinsamen Sorge und dem alltäglichen Da - Sein.
Wir werten diese Liebe gerne ab und in ihrem Extrem, der arrangierten Ehe, ist sie wohl auch überzogen, aber es liegt Würde und Menschlichkeit in dieser Art der Liebe. Wenn es uns als Gesellschaft gelänge, das romantische Ideal durch ein pragmatisches Ideal zu korrigieren, wäre viel Leid vermeidbar das aus den aktuell überzogenen Forderungen aneinander entsteht. Die pragmatische Liebe zeigt sich dort, wo wir für den anderen einstehen, bereit sind auch ein Opfer zu bringen, die schwierigen Seiten und Zeiten mitzutragen und trotzdem dazubleiben. Diese Liebe zeigt sich in Taten, nicht in Worten.
An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht: Das wars, das soll alles sein? Alles, was es in der Liebe zu erreichen gibt, sind Trauma-gesteuerte Verliebtheit und alltägliche Sorge? Nein. Das ist nicht alles. Es gibt noch eine Form der Liebe: die existenzielle Liebe. In ihr ist der Ursprung der Liebe als Antwort auf den Tod völlig durchsichtig und befreit vom Wunsch nach Erlösung. Existenziell liebt, wer als Sterblicher liebt. Der Schleier der Verliebtheit fällt, gesellschaftliche Normen verlieren ihren Anspruch auf absolute Gültigkeit, wir wagen Begegnung.
Existenzielle Liebe geschieht als resonante Rührung, sie lebt von der Wiederholung in der Begegnung, nicht von der Dauer in der Beziehung, wie die pragmatische Liebe. Ihr Wesen ist resonante Berührung im Bewusstsein der Vergänglichkeit. Diese Berührung meint Begegnung in der Tiefe, im Wissen um den Schmerz der Vergänglichkeit. Diese resonante Be-Rührung schafft etwas Besonderes: sie teilt das „Nichts“ im Innen, sie geht in Resonanz mit dem geteilten Trauma der sterblichen Existenz. Diese Berührung ersetzt kein NEIN durch ein JA, sondern teilt das NEIN. Wo diese Berührung stattfindet, kann sie starke Gefühle auslösen, die der Verliebtheit ähneln. Im Wesentlichen bewirkt diese Form der Liebe aber eine Öffnung, keine Sehnsucht. Eine Frau, die diese Berührung erfahren hat, fasst sie in diese Worte:
Es ist wie eine Berührung zweier Seelen - ein Gefühl, als ob das Universum sich öffnet, um mich zu umarmen.
Ich habe das Gefühl, dass wir eine Hülle nach der anderen abstreifen, bis zum Innersten unserer Seelen. Die Gefühle, die in mir entstehen in diesen Begegnungen werden mich nie wieder verlassen und es ist anders als bei jeder anderen Begegnung, die ich je hatte. Du öffnest Raum, um meine innersten Empfindungen sprechen zu lassen.
Existenzielle Liebe ist ein Geschenk, das wir einander machen können und sie verändert ein Leben.
Wie schenken wir diese Liebe? Dazu muss man wissen, dass existenzielle Berührung nicht an sichtbares Verhalten gebunden ist. Diese Liebe wirkt durch Schweigen ebenso wie durch einen Blick, ein Feedback oder ein Lachen. Ihre intensivste Form erreicht sie in der existenziellen Sexualität. Entscheidend ist jedesmal nur die tiefe Resonanz, die im geteilten Raum mitschwingt, um die „innersten Empfindungen sprechen zu lassen“. Existenzielle Liebe zeigt sich ausschließlich in der Haltung eines existenziellen Bewusstseins. Mit Pathos formuliert: es ist Liebe im Bewusstsein des Todes. In ihr liegt eine Dankbarkeit und eine Rührung, die sich nur einstellt, wenn wir lieben, als wäre es zum letzten Mal.
Diese intensive Berührung lässt sich nicht halten, aber sie lässt sich – wenn sie zur Lebenseinstellung wird – wiederholen. Der ANDERE bleibt dabei ein ANDERER, dem ich jedes Mal nicht nur begegne wie zum letzten Mal, sondern auch wie zum ersten Mal. Das Fremde und Unverfügbare des ANDEREN wird nicht nivelliert, es wird zur Quelle intensiver Begegnung. Unverfügbarkeit und Freiheit sind der Grund, warum wir einander immer wieder aufs Neue Geschenk sein können, nicht nur Gefährten.
Es ist möglich und häufig, dass dem Gegenüber eine existenzielle Berührung überhaupt nicht bewusst wird, denn äußerlich ist kein Unterschied zu sehen zu anderen Interaktionen des täglichen Lebens. Diese Unsichtbarkeit verbunden mit der dahinterliegenden absichtslosen Haltung sind aber geradezu Kennzeichen der existenziellen Liebe, die ihre Echtheit verlieren würde, wenn sie gewollt wird und bewusst hergestellt werden soll. Emmanuel Lévinas hat für dieses Paradox die passenden Worte gefunden, wenn er von einer Haltung der passiven Passivität spricht.
"Damit die Subjektivität rückhaltlos bedeute, durfte also die Passivität ihrer Ausgesetztheit gegenüber dem Anderen nicht sogleich sich umkehren in Aktivität, sondern musste sie ihrerseits sich aussetzen. Es braucht eine Passivität der Passivität..." (E. Lévinas. Jenseits des Seins und anders als Sein geschieht. Alber 2011. S. 313)
Existenzielle Liebe darf sich ereignen; wenn sie aktiv hergestellt werden soll, ist sie bereits inszeniert und dadurch pervertiert.
Tiefenresonanz bleibt unsichtbar, die Haltung dahinter absichtslos, wo sie sich ereignet, erkennt man sie ausnahmslos nur indirekt an ihrer Wirkung. Der Moment der existenziellen Berührung bringt ein Leben in Bewegung und stoppt traumagesteuerten destruktiven Zirkel. Ich habe es oft erlebt, dass existenziell geschenkte Liebe einem Leben neue Richtung verleiht: ein beruflicher Wechsel, eine neue Liebesbeziehung, ein lang gehegter Kinderwusch der sich erfüllt: große Veränderung die sich scheinbar von selbst ergeben.
Die existenzielle Liebe gilt nicht der Person, sie gilt dem Trauma, das in ihr wirkt. Daher hat sie keinen Bestand. Buber hat die Schwere erkannt, die darin liegt und sie in der ihm eigenen Sprache formuliert:
"Das aber ist die erhabene Schwermut unseres Loses, dass jedes Du in unserer Welt zum Es werden muss. … die Liebe selber kann nicht in der unmittelbaren Beziehung verharren; … " (M. Buber: Das dialogische Prinzip. Lambert Schneider 1997. S. 20f)
Es ist nicht möglich, in der seligen Liebe zu verweilen. Die Magie ist unverfügbar, man kann sie nur zulassen, offen bleiben für die Resonanz, aber man kann sie nicht herstellen, erzeugen oder lehren. Wo sie gewollt und inszeniert wird, ist sie schon verdorben. Sie steht damit im klaren Kontrast zur pragmatischen Liebe. Existenzielle Liebe ist keine Verliebtheit, keine gemeinsame Sorge, sie ist ein den-ANDEREN-sehen-wollen. Als Haltung bleibt sie unerkannt, so wie das Licht im Kosmos unsichtbar bleibt, bis es auf ein Gegenüber trifft.
Wie umgehen mit diesem Geschenk?
Häufig wird es – wie gesagt - nicht bemerkt. Ursache und Wirkung sind entkoppelbar, weil Unsichtbarkeit und Absichtslosigkeit walten. Der Quantensprung im eigenen Leben, der sich durch die Berührung ergibt, wird nicht in Verbindung gebracht mit der Erfahrung von existenzieller Liebe. Da wir in unserer Kultur keine Sprache, keine Literatur, keine Filme und Fallgeschichten zur existenziellen Liebeserfahrung haben, ist dies der häufigste Fall. Existenzielle Liebe ist sprachlos und bilderlos. Existenziell lieben bedeutet daher heute: Liebe ohne Anspruch auf Empfangsbestätigung oder Ausgleich. Sie ist Liebe ohne Forderung nach Erwiderung. Sie ist Geschenk nicht im Sinne einer Gabe, sondern im Sinne einer Resonanz. Dazu noch einmal Lévinas:
"Die einseitige Tat ist nur möglich in der Geduld; die bis ans Ende durchgehaltene Geduld bedeutet für den Handelnden: darauf zu verzichten, die Ankunft am Ziel zu erleben, zu handeln, ohne das gelobte Land zu betreten." (E. Lévinas: Die Spur des Anderen. Alber 2012. S. 216)
Existenzielle Rührung löst manchmal den Wunsch nach romantischer Liebe aus. Zumeist wird diese Liebe dann mit einem anderen Partner gelebt, manchmal aber auch auf den existenziell Liebenden zurückgebunden. Wenn diese Rückbiegung ihrerseits einen existenziell liebenden Anteil hat, kann sie zu einer pragmatischen Liebe führen, die ihre existenziellen Momente hat und in der es heißt: Ich liebe dich, aber ich mag dich auch. Wo dieser existenziell liebende Anteil fehlt, fällt die Geschichte sehr wahrscheinlich in die traumatische Liebe zurück und an ihrem Ende bleibt der resonante Mensch mit dem geteilten „Nichts“ zurück; als verlassener Fuchs oder böser Wolf im Märchen. Das ist die immer wieder auszuhaltende Gefahr für alle, die existenziell lieben.
Die Chance und der Lohn dieser Art zu lieben liegt in einem Leben, in dem es liebevolle Weggefährten ebenso gibt wie Momente der existenziellen Berührtheit. Wie alles, hat dieses Leben aber auch einen Preis. Der Preis für dieses Leben ist die Übernahme der Verantwortung für mich selbst. Die Welt schuldet mit nichts.
In den Worten von Emmanuel Lévinas:
"Die Kommunikation mit dem Anderen kann nur als gefährliches Leben Transzendenz sein, als ein schönes Wagnis, das eingegangen werden muss.
Der Verfolgte ist aus seinem Ort ausgestoßen und hat für sich nur sich – nichts auf der Welt, um das Haupt zu betten. Er kann sich nicht mit den Mitteln der Sprache verteidigen; dann das Eigentümliche der Verfolgung ist es, dass sie die Verteidigung ausschließt." (E. Lévinas: Die Spur des Anderen. Alber 2012. S. 322f)
Und damit zusammenfassend zurück zum Anspruch dieses Textes. Es geht darum, ein Verständnis und eine Sprache der Liebe zu entwickeln, das über rein biologische Erklärungen und romantische Ideale hinausgeht.
In meinem Verständnis wäre das eine Liebe, die auf drei Arten gelebt werden kann.
Wir dürfen in der Verliebtheit schwimmen, im Wissen, dass unter diesem Liebesozean eine abgründige Tiefe lauert. Wir dürfen Verliebtheit als Zeichen sehen, dass der Geliebte dem Verliebten etwas schenken kann. Dieses Geschenk wird nicht der ganze Mensch sein, aber vielleicht eine positive Gegenerfahrung zum traumatisierenden NEIN.
Wenn wir das Land der pragmatischen Liebe erreichen, sollten wir uns immer wieder daran erinnern, dass hier nichts selbstverständlich ist. Es gilt einander zu würdigen für die täglich immer wieder zu leistende Aufgabe des Füreinander und Miteinander. Wärme und Dankbarkeit sind die Pfeiler dieser Liebe.
Zuletzt gilt es offen zu bleiben für Resonanz im Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit. Lassen wir uns überwältigen von der Schönheit der Welt und des Geliebten.


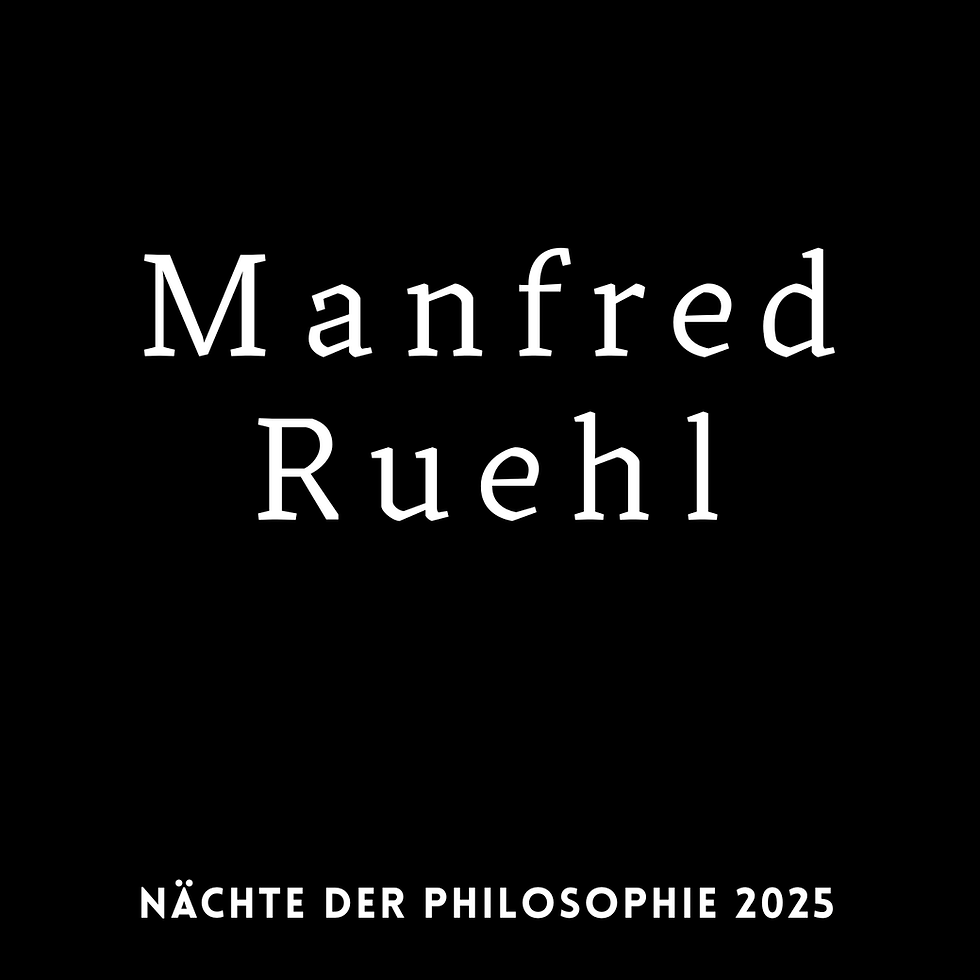


Kommentare