Soziale Mikrotraumata
- Manfred Rühl

- 11. Nov. 2020
- 2 Min. Lesezeit
Schauen wir auf uns
Man kennt das Phänomen aus dem Sport. Knochen brechen nicht notwendig durch plötzliche Krafteinwirkung, sondern manchmal aufgrund permanenter Überbeanspruchung. Ein ständiges „bisschen Zuviel“ erzeugt winzige Risse, die lange völlig unbemerkt bleiben können, bis am Ende eine kleine Ursache genügt, um großen Schaden anzurichten. Der Knochen bricht.
Dieses Phänomen lässt sich auf unser soziales Selbst in Zeiten von Corona übertragen:
Was wir gerade erleben, ist eine Mikrotraumatisierung auf sozialer Ebene. Die Regeln des Social Distancing erzeugen winzige Risse im sozialen Gewebe, die noch unbemerkt bleiben, aber dringend Beachtung verdienen.
Was unser Selbst und den sozialen Frieden betrifft, müssen wir uns über eines völlig im Klaren sein: wir begegnen anderen Menschen nicht, um Informationen zu senden und zu empfangen. Wir treffen einander, weil wir Begegnung brauchen, weil wir existenziell soziale Wesen sind, weil unser Selbst keine Insel, sondern eine Verflechtung ist, weil wir menschliche Wärme brauchen, um Mensch zu sein. Wir sind angewiesen auf wechselseitige Ansprache, auf gesehen werden, auf Miteinandersein, auf tiefen menschlichen Kontakt und Berührung. Metaphorisch hat das die Familientherapeutin Virginia Satir treffend auf den Punkt gebracht: wir brauchen vier Umarmungen täglich um zu überleben, acht um zu leben und zwölf um zu wachsen.
Social distancing traumatisiert unser soziales Selbst. Das passiert durch Masken und Abstände, Berührungsverbote, Reduktion auf Sachinformationen, das Fehlen von spiegelnder Mimik, Resonanzentzug und die Abwesenheit der vielen kleinen „Streicheleinheiten“ die wir gewohnt sind. Es fehlen die herzlichen Begrüßungen und Verabschiedungen, flüchtige Berührungen und Nähe-erfahrungen: ohne sie erleben wir eine soziale Deprivation, die uns Schaden zufügt, ohne dass wir das gleich bemerken. Unser Resonanz Körper wird traumatisiert. Ich fürchte, wenn dieser Zustand noch lange andauert, wird früher oder später etwas brechen.
Es ist schwer zu sagen, welche Folgen diese Mikrotraumatisierung haben wird. Im schlimmsten Fall wird Gewalt im Spiel sein aufgrund der fortschreitenden Ent-menschlichung. Es ist zu befürchten, dass, wenn wir erst einen gewissen Grad an sozialer Entfremdung erreicht haben, vor allem in Verbindung mit Arbeitslosigkeit und Perspektivenlosigkeit, ein kleiner Anlass reicht, um unseren Zusammenhalt nachhaltiger zu zerstören als es ein Virus könnte. Dahin dürfen wir es nicht kommen lassen.
Unten in der Büchse der Pandemie ist aber noch die Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir erst dadurch, dass es uns weggenommen wird, merken, was uns eigentlich am Wichtigsten ist und den Wert von Berührung und Zusammensein mehr schätzen lernen.
Was also tun?
So komplex die philosophischen Grundlagen zum „sozialen Selbst“ sind und so dramatisch die psychischen Auswirkungen der Deprivation, so trivial sind die Maßnahmen die uns schützen:
Die Verletzung durch Mikrotraumata im Sport verhindert man durch Trainingsplanung, die für gute Regeneration sorgt. Genau darauf sollten wir jetzt auch achten. Der Besuch bei der Familie, der Stammtisch, die Volleyballrunde und vor allem körperliche Berührung sowie alles, womit wir uns gegenseitig bestätigen und anerkennen, sind gerade jetzt wichtiger denn je. Mikroheilung unseres sozialen Selbst. So schauen wir auf uns.

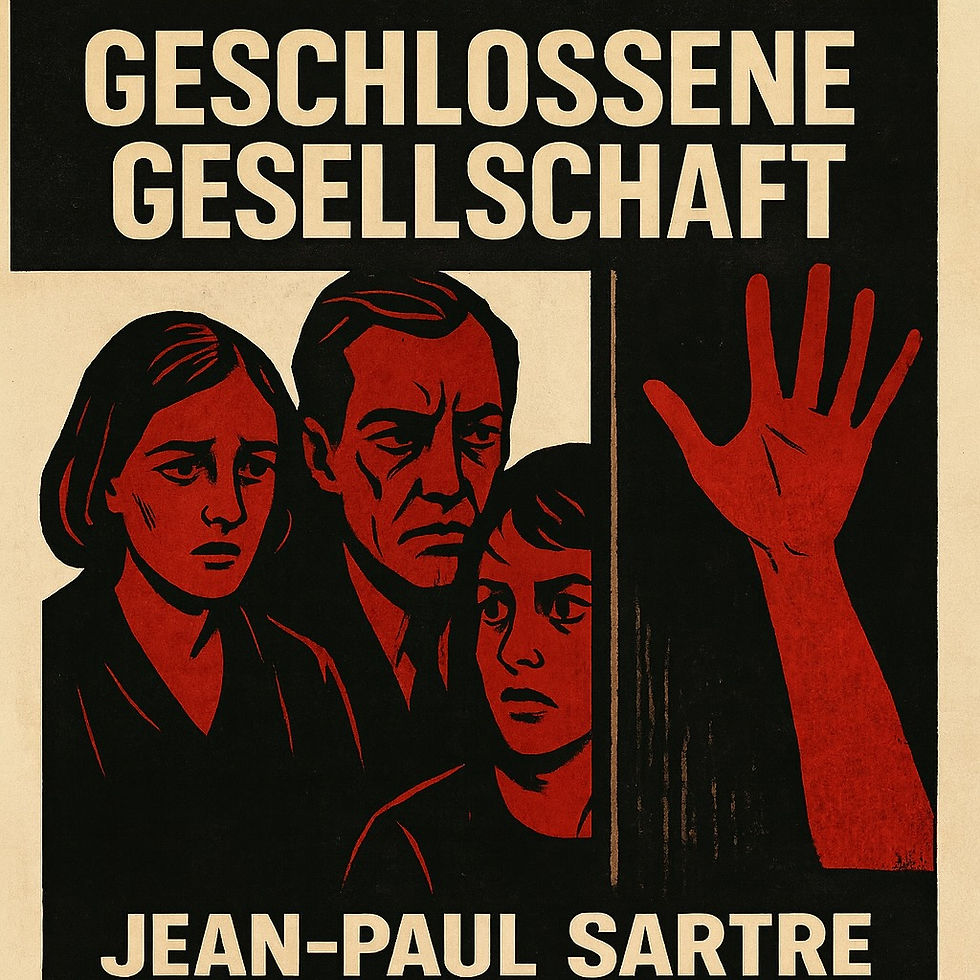


Kommentare